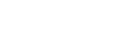Tom Frank Schetelich
Der König vom Augustusplatz
Tom Frank Schetelich
Die Wolken hängen in mattem weiß am Häuserhorizont. Ein Vogel flüstert Frühling in die Luft. Im Sonnentaumel des späten Nachmittags gewinnt mein Leben einen Moment dazu. Wer mag da schwärmen?
Menschen laufen durch meinen Blick, jeder auf der Suche nach etwas bestimmt-unbestimmtem mit gefühllos sehnendem Blick. Ein Mann präsentiert sich im jägergrünen Jackett auf einer Bank mit selbstdarstellerischem, wähnendem Blick - nicht aus Notwendigkeit (denn das wäre unmodern und deplatziert), sondern aus Berechnung - wer denkt, am besten mit romantischem Blick, wird nicht angesprochen in der Öffentlichkeit. Denken als Schutzmechanismus.
Nur wenn wir mögen, was wir bedenken, so vermögen wir zu denken. Nur weil die Möglichkeit des Denkens besteht, bedeutet das jedoch lange noch nicht, dass wir auch befähigt dazu sind - wenn wir diesen simpel daherkommenden Gedanken Heideggers folgen, erfassen wir das Dilemma unserer Zeit, in der keine Zeit mehr für Bildung, keine Zeit mehr für Eintracht besteht - aber auch dieser Diskurs erscheint deplatziert. Der Leser mag dies entschuldigen, ich wäre ihm zumindest verbunden dafür. Es ist nicht einfach, sich der Zeit zu nähern, wenn man selbst nur halb dazugehört. Dabei mag der Leser wohl an die Berechtigung des Alters denken, nicht alles Moderne gutheißen zu müssen - aber diese Berechtigung ist längst verspielt und ich bin etwa 23 Jahre alt, schätze ich, vielleicht aber auch viel älter, wenn man meinem Gefühl Glauben schenken mag – aber wer tut das schon? ich bleibe unbestimmt bestimmt.
Menschen sehnen sich nach einem Sinn, sehnen sich nach einer Lebensaufgabe, die größer ist als sie selbst – aber nicht mehr. Das Detail bleibt verloren. Das Denken kommt ins Stocken. In martialischem, anschwellendem Stakkato hämmern Fragen in den Geist ein: Was? Wie? Was? Was? Ich? Was? Wie? Was? Ja was nur? Was? – eine simple, aber in ihrer Einfachheit umso schwerere Melodie – und plötzlich die Fuge: Warum tue ich mir das an? Dieser Gang ist viel zu schwer. Es muss nicht sein, ich kann nicht mehr – Beethovens Es muss sein! war vor hundert Jahren vielleicht noch en vogue.
Die Wolken nähern sich in behäbiger Imposanz von Süden. Je näher sie kommen, desto heller erstrahlen sie im Sonnenlicht – oder ist das nur Eindruck? vielleicht. Aber wer den Augen nicht traut, verschließt sich der Phantasie. Ein Vogel fliegt über den weiten Platz und landet auf einem elysischen Engel. Das Kindsgesicht heißt den neuen Gast in regloser Anmut willkommen. Der weiche, sanfte Wind verfängt sich in meinem Bart und lässt das Haar wanken. Ein kleiner Gedanke planscht im Wasser des Brunnens. Fasziniert folgt er den Reflexen der Oberfläche. Mit Wasser ist es, wie mit Menschen, denke ich mir, es geht immer nur um Aktion und Reaktion – ein Spezialgebiet von mir, wenn man so will, mein täglich Brot. Nur heute nicht, heute genehmige ich mir einen freien Tag. Eine Frau von vielleicht siebenundzwanzig, vielleicht auch dreißig Jahren läuft nah an mir vorbei. Ihr Blick bleibt konzentriert auf irgendein Ziel in der Ferne, bestimmt-unbestimmt. Ihr blau-weiß gepunktetes Kleid erzählt von warmen Sommerabenden, die braunen Stiefelletten wollen nicht recht dazu passen. Ich schmunzle sie an – schon ist sie vorbei.
Ein Gedanke von Unendlichkeit läuft über den weiten Platz auf mich zu. Ich kenne ihn, er ist mir vertraut, und dennoch sieht er jedes Mal anders aus. Heute ist er ein kleines Kind von etwa fünf Jahren, ein Mädchen – die meisten meiner Gedanken sind weiblich, besonders die schönen … aus ästhetischen Gründen, denke ich. Vielleicht komme ich mit Männern aber einfach nur schlechter zurecht. Das Mädchen setzt sich auf die Mitte des Platzes und schaut die vorbeirennenden Menschen an, beobachtet ihre Schritte mit gedankenlosem Blick. Unendlichkeit ist immer gedankenlos. Wenn sie anfängt zu denken, hört sie auf zu sein, weil Gedanken zutiefst endlich sind. Es gibt viele Gedanken: kleine, große, schöne, bedrohliche, herzige, warme, kalte, logische, affektierte, pompöse, ordinäre, behäbige, vertraute, besondere, verstopfte, vergessene, zwinkernde, beruhigende …
Es gibt viel mehr Gedanken als Denker. Sie alle vereint, dass sie endlich sind, dass sie sterben können und müssen. Gedanken können drei Wege gehen: entweder sie verlieren sich im Nichts, sie werden anderen Menschen geschenkt, oder sie gehen ins Gedächtnis ein und werden dort, mal mehr, mal weniger oft immer wieder neu geboren, bis sie eines Tages ebenfalls sterben oder auf einen anderen Menschen übergehen und in ihm ein Stückchen weiterleben, bis sie wieder vor der selben Weggabelung stehen. Nur manchmal verirrt sich ein Gedanke aus einem Menschen heraus in die Welt. Das kleine Mädchen hebt den Blick und schaut mich an, wie ich auf meiner Bank sitze. Meine Parkbank steht, wie gesagt, auf einem Platz, aber nicht auf irgendeinem Platz, das wäre allzu profan, nein, sie steht auf meinem Platz, dem Augustusplatz zu Leipzig. Nicht, dass hier ein Missverständnis entsteht – natürlich heiße ich nicht Augustus, das wäre famos, aber eine Umbenennung in Friedrichplatz würde sich nicht durchsetzen. Ohnehin wäre es kein Zeichen von Größe, wenn der Herrscher nur zu seiner eigenen Befriedigung sein Reich nach ihm benennen würde. Nein, er begnügt sich damit, seine Macht im Beinamen zu tragen. Als Wilhelm II. 1888 inthronisiert wurde, hielt er sich auch zurück, das ganze Reich in Wilhelminisches Reich umzubenennen und das trotz seiner prominenten pathologischen Geltungssucht. Man stelle sich den bürokratischen Aufwand vor, jeden Briefkopf zu ändern, jedes Amt neu auszustatten, jeden Pass neu auszustellen – ganz zu schweigen davon, eine neue Hymne, einen neuen Pathos, ein neues Nationalgefühl zu etablieren … und wenn man sich auch sonst kein Beispiel an Wilhelm nehmen kann, so tue ich es doch in diesem Falle und begnüge mich mit dem Titel Friedrich I., König des Augustusplatzes, Großherzog vom Mendelbrunnen.
Der Leser mag nun innerlich Haltung annehmen, zumindest erfahre ich diese Reaktion des Öfteren, wenn ich mich vorstelle. Aber keine Sorge, er darf sich rühren, das Zeremoniell der modernen Zeit sieht keinen besonderen Respekt vor Adelstiteln mehr vor. Überhaupt ist meine Regentschaft in Zeiten der Demokratie ziemlich begrenzt, wenn nicht gar behindert. Ich darf nur noch über die unbelebten Dinge in meinem Reich verfügen, und über jene, die mir freiwillig folgen. Ansonsten gilt die Autorität des Volkes. Es sind wahrlich merkwürdige Zeiten, aber es ist nicht allzu verwunderlich: Schaut man sich die Deutschen an, so ignorieren sie konstant und sehr erfolgreich, dass sie eine Geschichte vor den zwei Weltkriegen haben. Da ist es nur verständlich, dass sie mit einem König und Großherzog nicht allzu viel anzufangen wissen.
Das kleine Mädchen ist verschwunden, es war wohl gelangweilt. Ich zünde mir eine Zigarette an. Die Sonne nähert ich immer weiter dem Horizont. Längst ist sie hinter den Häusern der Innenstadt herabgesunken und färbt die nun nahen Wolken in einem satten Orange. Menschen rennen mit Tunnelblick über den Platz, die Feierabendzeit ist angebrochen. Im schwindenden Sonnenlicht sagt ein Gedanke adieu. Die Welt zerfällt in rennende und harrende Menschen. Die harrenden warten, dass etwas passiert. Die rennenden laufen auf ihr Ziel zu und stürmen es um. Der Gedanke war voll Glück. Ein umgestürmtes Ziel ist ein verlorenes. Die Wolken färben sich rubinrot. Der König verneigt sich und tötet. zumindest bei Herta Müller. nicht bei mir. Der König verneigt sich ist treffender. Verneigung hat etwas von Abschied und Willkommen in einem. Ein König kann nicht mehr töten; der Purpur ist zu gesättigt. Ein Roter Kardinal kreist über meinem Platz. Im Wolkenschein erscheint er als Phoenix. Die Menschen verlieren sich in sich selbst. Niemand rennt mehr, jeder steht aber nicht mehr. Selbst das Warten ist beendet. Das rote, tiefrote Wolkenmeer ergießt sich in die Köpfe der Menschen und macht sie still und macht sie klein. Vor der Weite des Horizonts, der Höhe des Himmels ist kein Mensch gewappnet. Die Gedanken nehmen Reißaus. Wo Gedanken Reißaus nehmen, verliert sich der Sinn. Mit roten Wolken im Kopf lässt es sich nicht denken, noch weniger fühlen. Aus gutem Grund, schätze ich.
Der Kardinal kreist noch immer unaufhörlich über den Köpfen der Menschen. Stumm und starr erstaunen sie vor der Welt. Ein Schauer erfasst mich Außenstehenden. Der Kardinal zerstiebt. Die Welt überholt sich selbst in Augenschlägen. Er war doch nur ein Gedanke, denke ich mir etwas enttäuscht und schaue meinem Purpur beim Erröten zu. Die Menschen laufen langsam wieder an. Das Rot der Wolken hat sie erhitzt.
Entschuldigung, ich ärgere mich über mein Nur. Es war sicherlich nicht nur ein Gedanke. Wer wäre ich, wenn ich derart abfällig urteilen würde? Sicher kein König … mein Volk besteht aus Gedanken. Die Menschen brauchen keinen König mehr. Sie sind zu erhitzt, zu rabiat, zu schnell, viel zu schnell. Mit der Überwindung der decádence verliert sich eine ganze Zivilisation im Leistungswahn - und das Schlimmste für mich: es ist verständlich. Der Mensch erlebt im zwanzigsten Jahrhundert, dass der Weltuntergang nur ein Hirngespinst ist, nicht eintreten wird, und fällt aus der Dekadenz in eine nie dagewesene Gewaltorgie. Als er vor sich selbst erschrickt, ist es schon zu spät, er mäßigt sich, um wiedergutzumachen. Doch jede Wiedergutmachung hat ein Ende, und Kultur vergisst nicht. Sie erinnert sich an die Überwindung des Unüberwindbaren und fühlt sich unsterblich. Die Menschen werden postdekadent – was, in meinem Empfinden, viel gefährlicher ist, weil Dekadenz plötzlich ohne Ziel in alle Richtungen ausgreift, ohne sein eigenes Ende zu postulieren. Der Mensch verfällt in individualistische Allmachtsphantasien und verliert dadurch sein Menschsein. Er bestimmt sich selbst zur Perfektion und ignoriert sein Scheitern. Wo bleibt da der Sinn? das Schwärmen? das Schöne? Gedanken irren herrenlos umher und finden keinen Eingang mehr, sie siechen langsam dahin, bis sie endlich sterben - der Mensch schafft sich selbst ab. Ein Übermensch bleibt ungeboren. Die Wüste wächst: weh Dem, der Wüsten birgt! Wo bleibe ich?
Dort, wo ich immer war? Der König vom Augustusplatz? Herrscher über herrenlose Gedanken? Welchen Zweck hat das noch? Ändern sich Zeiten? Ändern sich Menschen? Wenn man Schopenhauer Glauben schenken mag, so sind Menschen nicht fähig zur Veränderung. Alle Verhaltensanpassung ist nur Dressur, nur schlechtes Maskenspiel. Ich weiß nicht, ob ich Schopenhauer mag aber ich mag den Regen. Ich verliere mich.
Die Menschen rennen wieder. Sie stürzen in Anzügen und Kostümen aus den Häuserschluchten der Innenstadt über meinen Platz, hinein in die Straßenbahnen, hinaus in die Stadt. Einige bärtige Männer in weißen Gewändern verteilen Handzettel an desinteressierte Passanten. Die Sonne hat den Horizont überschritten und bescheint nur noch den Himmel, der sich in sanftem Orange langsam zur Empfehlung schickt. Eine Frau in glänzend schwarzem Kostüm und rotem Schuh bleibt dreieinhalb Meter vor mir stehen, das Ohr am Telefon. Ja, nein, das Brot ist im Tiefkühler, Mama kommt bald heim. Nimm dir einen Joghurt bis dahin … oder etwas anderes. Ich schmunzle sie an, sie sieht durch mich hindurch. Das Rot war immer Blut. Sie geht so schnell, wie sie kam, mit ihr all die anderen kostümierten Menschen. Es wird zusehends dunkler. In der Dunkelheit gehört mein Reich nur mir und meinen Bürgern. Meine Bürger sind alle, die mir folgen wollen. Es sind hauptsächlich Gedanken, manchmal auch ein Mensch, vielleicht – ich kann sie nicht gut unterscheiden. Ich lebe hier, auf diesem Platz, an diesem Brunnen. Mein Bett ist meine Bank, mein Thron. Ich weiß nicht mehr, wann ich geboren, ob ich geboren wurde, und so weiß ich auch nicht, wann ich sterben werde. Menschen haben Erinnerungen, hat mir mal ein Gedanke erzählt. Ich nehme einen Schluck Wein aus der Flasche. Aber dieser Gedanke sagte mir auch, dass Menschen Bewusstsein haben. Nicht jedem kann man trauen.
Die Nacht bricht herein, mein verlebtes Reich steht illuminiert. Morgen früh werden Menschen kommen und es für mich herrichten, wie jeden Tag. Wie jeden Tag erhebe ich mich, werfe den Purpur über mein Bett und lege mich hinein. Wie jeden Tag? Ich weiß nicht mehr, was gestern war, oder vorgestern, oder letzte Woche. Ich weiß, dass ich hier schon lange bin, aber wie lange? Zeit war mir nie wichtig. Menschen haben Erinnerungen. Ein Gedanke läuft über meinen Platz und setzt sich neben mir auf den Steinboden. Es ist ein Junge, vielleicht zehn, mit blondem Haar. Ich mag keine blonden Menschen. Er spricht nicht, schaut mich nur an. Ich schließe die Augen. Es ist dunkel.