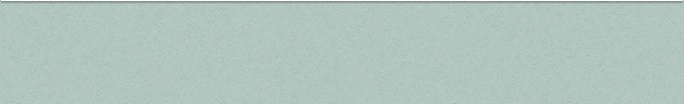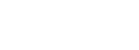Stephan Leuenberger
Keine oder zwei Muttersprachen?
Welche Sprache ist meine Muttersprache? Das sollte eigentlich keine schwierige Frage sein. Aber für die meisten jener Leute, die wie ich aus dem sogenannten „deutschsprachigen” Teil der Schweiz stammen, ist die Antwort nicht ganz einfach.
Offiziell – für den Zweck einer Volkszählung, oder für amtliche Dokumente – ist meine Muttersprache Deutsch. Deutsch ist die Sprache, die ich zuerst lesen und schreiben gelernt habe, und es war die hautptsächliche Unterrichtssprache in meiner Schule.
Trotzdem fühlt sich Deutsch für mich und für viele andere Deutschschweizer nicht wirklich wie eine Muttersprache an. Mit „Deutsch” meine ich hier die deutsche Hochsprache oder Standardsprache, die von diversen Dialekten, von denen ich noch sprechen werde, zu unterscheiden ist. Zu Hause in unserer Familie haben wir nie Hochdeutsch gesprochen, mit Ausnahme der wenigen Gelegenheiten, wo wir ausländische Gäste hatten. Das gleiche im Freundeskreis: es wäre uns nicht in den Sinn gekommen, Deutsch zu sprechen. Sogar in der Schule haben wir Hochdeutsch vermieden, wann immer wir konnten. Zum Beispiel in den Schulfächern, in denen das Gesetz Hochdeutsch nicht vorschrieb: Zeichnen, Singen und Turnen. (So wurden die Fächer genannt, als ich zur Schule ging. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie heute „Kunst”, „Musik” und „Sport” hiessen.) Sobald die Pausenglocke klingelte, wurde kein Wort Hochdeutsch gesprochen. Wenn ein Schüler mit dem Lehrer oder der Lehrerin in der Pause noch etwas besprechen musste, war das nie auf Deutsch.
Da wir ausserhalb der Schulstunden kaum Deutsch sprechen, mangelt es vielen vielen Deutschschweizern an Selbstvertrauen im mündlichen Ausdruck. Ich bin da keine Ausnahme. Wenn ich Deutsch spreche, bin ich oft unsicher, ob ich die richtigen Worte wähle, und vor allem, ob ich schnell genug spreche. (Beim Schreiben ist dies viel weniger ein Problem. Ich habe viel mehr Übung darin, Deutsch zu schreiben als zu sprechen.) Viele Deutschschweizer leiden deshalb an Minderwertigkeitsgefühlen, weil sie weniger eloqent sind als Deutsche. Das kann schon mal auch Nachteile im Berufsleben haben. Wenn sie jemand zum Beispiel für einen Lehrstuhl an einer Universität bewirbt, muss er oder sie eine Probevorlesung halten – auf Deutsch natürlich. Oft sind die meisten Kandidaten Deutsche. Die wenigen Schweizer, die eine Probevorlesung halten dürfen, wirken im Vergleich oft wenig gewandt oder sogar hölzern im Ausdruck, was natürlich ihre Chance mindert, die Stelle angeboten zu kriegen.
Welche Sprache sprechen wir denn in der Deutschweiz zu Hause oder im Freundeskreis, wenn nicht Deutsch? Wir sprechen Schweizerdeutsch, genauer gesagt eine bestimmte lokale Variante davon. Die Varianten werden jeweils nach der Gegend benannt, in welchem sie gesprochen werden. Ich bin im Kanton Bern aufgewachsen – Kantone entsprechen verfassungsrechtlich ungefahr den amerikanischen Bundesstaaten, sind aber natürlich viel kleiner – und spreche deshalb Berndeutsch. Das bekannteste Merkmal des Berndeutschen ist, dass es typischerweise langsam gesprochen wird. In der Schweiz wird allgemein viel langsamer gesprochen als in Deutschland, und im Kanton Bern nochmals langsamer als in der übrigen Schweiz. Diese Geschweindigkeit entspricht dem bedächtigen Wesen der Berner. Über die Berner Langsamkeit macht sich die ganze Schweiz lustig. Zum Beispiel: Weshalb lacht ein Berner über jeden Witz dreimal? Er lacht zum ersten Mal, wenn der Witz erzählt wird; zum zweiten Mal, wenn der Witz ihm erklärt wird; und zum dritten Mal, wenn er den Witz versteht.
Schweizerdeutsch wird normalerweise nur gesprochen, nicht geschrieben. Es gibt Autoren, welche Geschichten oder Gedichte auf Deutsch verfassen. In den letzten zwei oder drei Jahrzehnten ist Schweizerdeutsch vermehrt auch im privaten schriftlichen Verkehr verwendet worden, zum Beispiel auf Urlaubspostkarten oder in SMS-Botschaften auf Mobiltelefonen. Ich selber habe diese Entwicklung nicht mitgemacht, und nicht nur deshalb, weil ich seit fünfzehn Jahren im englischsprachigen Ausland lebe. Ich bin es einfach nicht gewohnt, Berndeutsch zu schreiben. Ja, ich finde es sogar schwierig, Berndeutsch zu lesen. Ich erkenne die Wörter mit der ungewohnten Schreibung oft nicht auf Anhieb, sondern erst dann, wenn ich sie zurück in Laute verwandle – indem ich sie mir entweder selbst laut oder zumindest in der Einbildung vorlese. Es hat zwar Versuche gegeben, die Schreibung des Berndeutschen zu standardisieren, aber wie die grosse Mehrheit der Bevölkerung bin ich damit nicht vertraut.
Ich habe bisher so getan, als ob Deutsch und Schweizerdeutsch oder Berndeutsch verschiedene Sprachen seien. Es ist aber nicht klar, ob dem so ist. Meistens wird Berndeutsch als ein Dialekt des Deutschen betrachtet. Nun ist aber die Unterscheidung zwischen einer Sprache und einem Dialekt nicht scharf und zu einem gewissen Grade willkürlich. Man könnte meinen, sie habe mit dem Grad der Übereinstimmung der Grammatik und des Wortschatzes zu tun. (Manchmal wird gesagt, dass in einem anderen Dialekt nur die Vokale anders sind, in einer anderen Sprache aber auch die Konsonanten.) Auf dieses Thema werde ich noch zurück kommen. Dass die Unterscheidung nicht nur von solchen Faktoren abhängt, wird von Linguisten gelegentlich mit dem folgenden Bonmot zum Ausdruck gebracht: “Eine Sprache ist ein Dialekt mit einem Heer und einer Flotte.” Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Schweiz ein Heer hat – die Schweizer Armee. Als Binnenland hat sie keine Flotte auf dem Meer, aber immerhin ein paar Boote auf den Schweizer Seen. So könnte man argumentieren, dass Schweizerdeutsch tatsächlich eine Sprache und nicht nur ein Dialekt ist. Wenn man das Zitat aber mehr sinngemäss als wörtlich nimmt, sieht die Sache anders aus. Schweizerdeutsch wird politisch und institutionell nicht als eigenständige Sprache gefördert: es wird in der Schule nicht gelehrt, wie ich schon berichtet habe, und Gesetzestexte und der offizielle Schriftverkehr der Behörden werden nie auf Schweizerdeutsch verfasst. Die Schweiz hat nicht weniger als vier offizielle Landessprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Schweizerdeutsch ist aber keine Landessprache. Um zur Metapher zurückzukehren: das Heer und die Flotte werden nicht zugunsten des Schweizerdeutschen eingesetzt. Insofern ist Schweizerdeutsch ein Dialekt, und nicht eine eigenständige Sprache.
Wie gross sind denn nun die Unterschiede zwischen Deutsch und einem bestimmten Dialekt, wie etwa Berndeutsch? Gross genug, dass Deutsche den Dialekt nicht verstehen können, jedenfalls nicht auf Anhieb. Sie haben auch nicht die Erwartung, ihn verstehen zu können. Für viele Deutschschweizer sind an die folgende Situation gewohnt: Sie sprechen mit einer Person aus Deutschland und geben sich grösste Mühe, sich auf Deutsch korrekt auszudrücken, wie sie es in der Schule gelernt haben. Der Gesprächspartner oder die Gesprächspartner gibt dann seinen oder ihren Stolz darüber zum Ausdruck, das angeblich so schwierige Schweizerdeutsch verstehen zu koennen. Unser bestes Hochdeutsch wird also für Schweizerdeutsch gehalten! Der Grund dafür ist, dass die meisten Schweizer Deutsch mit einem leicht erkennbaren Akzent sprechen, und zudem auch hin oder wieder charakteristisch schweizerische Woerter, sogenannte “Helvetismen”, einstreuen. (Helvetismen sind nach den Helvetiern benannt, einem Keltenstamm, welche das Gebiet der heutigen Schweiz vor den Römern besiedelten.) Aber es ist eines, mit einem Akzent zu sprechen und Helvetismen zu benutzen – wie es schweizerische Schriftsteller wie Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch taten, die in Deutschland grosse Erfolge feierten – und es ist etwas ganz anderes, Schweizerdeutsch zu sprechen. Deutsche verstehen Schweizerdeutsch nicht einfach so, obwohl wir Schweizer ja recht langsam sprechen. Süddeutsche koennen sich typischerweise die Fähigkeit, es zu verstehen, recht schnell aneignen, wenn sie in die Schweiz ziehen. Für Norddeutsche dauert das etwas länger.
Wenn ich über Unterschiede in der Grammatik und im Wortschatz berichte, werde ich mich auf meinen Dialekt, das Berndeutsche, konzentrieren. Ein bedeutender Unterschied zum Deutschen besteht im Tempussystem, den grammatikalischen Zeiten. Im Deutschen gibt es die Unterscheidung zwischen dem Perfekt einerseits – „ich bin gegangen”, „ich habe gelesen” – und dem Imperfekt oder Präteritum andererseits – „ich ging”, „ich las”. Diese Unterscheidung haben wir im Berndeutschen nicht. Wir haben zwar das Perfekt, das auch mit Hilfsverben gebildet wird, aber wir haben kein Imperfekt. Wir erzählen Geschichten aus der Vergangenheit deshalb im Perfekt. Da wir keine Imperfektformen haben, können wir auch kein Plusquamperfekt auf dieselbe Art wie im Hochdeutschen bilden, mit dem Hilfsverb im Imperfekt – „ich war gegangen”, „ich hatte gelesen”. Stattdessen bilden wir eine entsprechende Zeitform mit einem Hilfsverb im Präsens und zwei Partizipien – etwa „ich bin gegangen gewesen” oder „ich habe gelesen gehabt”.
Das Beispiel der fehlenden Imperfektform mag den Eindruck erwecken, dass Berndeutsch im allgemeinen eine vereinfachte Grammatik hat. Dem ist aber nicht so. In gewissen Hinsichten ist die Grammatik komplizierter. Zum Beispiele gibt es mehr Numerale, die ihre Endungen je nach dem Genus oder grammatikalischen Geschlechts des Nomens. Im Deutschen unterscheidet man “ein” und “eine”, je nachdem ob das folgende Nomen männlich oder sächlich (“ein Mann”, “ein Kind”) oder weiblich ist (“eine Frau”). Das Zahlwort “zwei” hingegen wird für alle drei Genera gebraucht (“zwei Männer”, “zwei Frauen”, “zwei Kinder”). Im Berndeutschen hingegen gibt es drei verschiedene Zahlwoerter für „zwei” (ungefähr wie „zwe”, „zwo”, und „zwoei” ausgesprochen). Für drei benutzen wir noch zwei verschiedene Formen („drei”, „drü”). Erst von der Zahl vier an gibt es nur eine Form.
Allerdings muss festgestellt werden, dass der Dialekt an Formenreichtum verliert. Die Zahlwörter können auch hier als Beispiel dienen. In meiner Generation sind zwei der drei Formen für „zwei“ weitgehend verschwunden. Ich mache die Unterscheidung auch nur deshalb, weil ich in einer Familie von Lehrern aufgewachsen bin, wo die Eltern darauf achteten, dass die Kinder den Dialekt korrekt sprachen – wobei der Masstab für die Korrektheit natürlich jener der vorherigen Generation war.
Was den Wortschatz betrifft, werden die Unterschiede zwischen Deutsch und Dialekt auch geringer. Dialektwörter, die im Deutschen nicht vorkommen, betreffen hauptsächlich den häuslichen und landwirtschaftlichen Bereich. Für wissenschaftliche, technologische oder abstrakte Begriffe übernimmt der Dialekt das Wort typischerweise direkt aus dem Deutschen, oder heute gelegentlich aus dem Englischen. Nur die Aussprache wird ein bisschen angepasst. Rundfunk, Fernsehen und die zunehmende Mobilität der Bevölkerung tragen auch dazu bei, dass sich der Wortschatz langsam angleicht.
Wie ist nun meine im Titel gestellte Frage zu beantworten? Habe ich zwei Muttersprachen, Deutsch und Berndeutsch? Oder keine, weil ich Deutsch erst in der Schule gelernt habe und Berndeutsch keine eigenständige Sprache ist? Ich muss dem Leser leider eine aufschlussreiche Antwort schuldig bleiben. Es kommt halt darauf an, was man mit „Muttersprache“ meint.