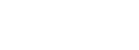Steffen Kamenicek
Lucky
Steffen Kamenicek
Brezel wurde schon so lange Brezel genannt, dass er seinen richtigen Namen irgendwann vergessen hatte. Er saß auf einem kaputten Traktor irgendwo in der Einöde zwischen Feldern und Autobahn und blickte auf ein verfallenes Haus an den Bahngleisen. Er wusste auch nicht mehr, warum sie anfingen, ihn Brezel zu nennen. Es muss wohl irgendwann auf der Straße gewesen sein, wo sonst. Brezel war nie irgendwo anders als auf der Straße. Brezel kannte sich aus mit Straßen, er wusste um die Spalten im Bordstein und die warmen Lüftungsschächte, die Karibik. Ey Brezel wo hastn geschlafen. – In der Karibik. – Ich war in Sibirien Alter. Kein Scheiß. – Brezel trank einen Schluck Bier. Das Haus kannte er gut, er hatte dort vor vielen Jahren einen Sommer lang mit Lucky an einem Schutthaufen gewohnt. Am Mount Everest. Irgendwann hatten sie zwischen dem Schutt ein altes Fotoalbum gefunden, das ein unbekanntes Ehepaar an weit verstreuten Orten zeigte, immer dasselbe linkische Grinsen auf dem Gesicht. Sie hatten die Gesichter mit ihren eigenen Gesichtern übermalt und die Bilder mit Unterschriften versehen. Brezel und Lucky am Times Square. Brezel und Lucky in der Oper. Da fing Lucky immer an, Wagner zu singen, denn er hatte einmal ein paar Wochen in einem Abstellraum im Konzerthaus verbracht. Brezel und Lucky am Strand. Italien hatten sie daruntergeschrieben, obwohl keiner wusste, wo es war. Einmal in der Stunde flog der Zug vorbei. Brezel und Lucky auf dem Mount Everest war das letzte Bild im Album, da standen sie auf dem Schutthaufen und haben mit einer gefundenen Einwegkamera ein Bild gemacht und entwickeln lassen. Aus irgendwelchem Abfall hatten sie noch einen Yeti dazu gebastelt. Brezel schüttelte den Kopf und warf die Bierflasche ins Feld. Für ein paar Wochen hatten sie auch einen Hund, der kam einfach angelaufen und irgendwann ging er wieder. Sie hatten nicht viel zu fressen für das Vieh, aber sie haben den ganzen Tag mit ihm gespielt. Einmal sagte Lucky, sie seinen Romulus und Remus, denn sie seien von dem Hund viel abhängiger als er von ihnen. Dann hatte Lucky aus einem Pappkarton das Kolosseum geschnitten und gesagt, wir sind jetzt in Rom. Sie hatten dazu Lambrusco getrunken und den ganzen Abend Latein gesprochen, aber Brezel konnte nur Alea Iacta Est sagen und Lucky O Sole Mio, was streng genommen gar kein Latein war. Aber Lucky stand vor ihm mit einer Toga aus einer Plastikplane und einem Lorbeerkranz auf dem Kopf, den er aus ein paar Grashalmen geflochten hatte. Weißt du wo ich auch mal hinwill, Brezel, hatte Lucky gesagt. Nach Afrika. Zu den Elefanten. Da war er zum Zirkus gelaufen und hatte sich ins Lager geschlichen, aber er hatte sich verlaufen und wurde beinahe von einem Tiger aufgefressen. Danach war Lucky nie wieder zum Zirkus gegangen. Was soll ich in Afrika, hatte er gesagt. Ich fahr lieber irgendwo anders hin. Nach Sibirien. Spinnst du, hatte Brezel noch zu ihm gemeint, kalt wird’s noch früh genug. Quatsch doch, hatte Lucky gesagt, im Sommer ist es da auch warm. Woher Lucky immer solche Sachen wusste. Am selben Abend war Lucky in den Stadtwald gelaufen und hatte sich zwischen ein paar Kiefern niedergelassen. Brezel war mitgelaufen, weil er sonst nichts zu tun hatte. Wie in Sibirien, sagte Lucky im Stadtwald. Unendliche Weiten. Tatsächlich hatten sie den ganzen Abend keine Menschenseele gesehen, aber als sie am Morgen aufwachten, liefen ein paar prustende Hausfrauen in rosafarbenen Jogginganzügen vorbei. Den ganzen Heimweg imitierte Lucky die schnaufenden Walrösser. Sibirien ist wohl auch nix, hatte er gesagt, und dann hatten sie sich zusammen das Album angeschaut. Dann fahren wir halt nach Oberbayern, hatte Lucky gesagt. Da wird’s friedlich sein. Dann hatte er den ganzen Abend behauptet, sein Name sei in Wirklichkeit Franz Xaver aus Hintertupfing und hatte mit seinen X-Beinen geschuhplattlert. Nachdem er irgendwann betrunken umgefallen war und sich dabei den Kopf aufgeschlagen hatte, saß er auf seiner Matratze und sagte, ach leck mich doch, dann bleib ich halt zu Hause.
Irgendwann kam die Stadtverwaltung in orangenen Westen und sagte, ihr müsst da jetzt raus. Am selben Abend hatte sich Lucky die Pulsadern aufgeschnitten. Da hatte Brezel sein Hemd zerrissen und den Arm abgebunden, und dann hatte er gesagt, wenn du das noch einmal machst, dann hau ich dir die Fresse ein. Danach hatte sich Lucky auf die Gleise gelegt, aber die Regionalbahn hatte zehn Minuten Verspätung und so konnte Brezel ihn noch rechtzeitig runterziehen. Da hatte Brezel Lucky dann die Fresse eingeschlagen. Du beschissener Depp, hatte er gebrüllt, du Nichtsnutz. Da war Lucky einfach aufgestanden und gegangen. Ein paar Nächte später kam der erste Frost. Brezel sah ihn danach nur noch einmal wieder. Das war nach dieser Nacht über dem Lüftungsschacht, als Lucky dann plötzlich auf der Straße stand und sagte, Sibirien Alter. Zwei Nächte später war Lucky tot, erfroren. Im Stadtwald. Brezel war als Einziger am Grab gestanden und hatte einen Kater gehabt.
Steffen Kamenicek – 2nd story
Horsch Worscht Dorscht
Obwohl es in Aschaffenburg zu jeder Jahreszeit schrecklich sei, so Steindörfler zu Petermann, während er im Schlappeseppel in seine Wurstsemmel biss, sei es im Frühjahr am allerunerträglichsten. Dies sei maßgeblich auf das schöne Wetter zurückzuführen, denn sobald die Sonne scheine, schmissen sich alle Aschaffenburger in ihre Festtagsuniformen, und gerade im Frühjahr gebe es eine Vielzahl dieser abstoßenden Feierlichkeiten, wie zum Beispiel das Waldfest, oder das Volksfest, oder die sogenannten Maibaumfeiern, wo man sich im Namen der Freiwilligen Feuerwehren und der Schützenvereine unter einen großen Maibaum setze und Rindswürste, Bratwürste und Leberkäsebrötchen in großer Zahl in sich hineinstopfe, bevor man diese mit Bier aus Maßkrügen hinunterspüle. In der Regel schlage dann noch irgendjemand vor, das Menü mit Fruchtschnäpsen abzurunden, den sogenannten Pfläumchen oder Kleinen Feiglingen, die man nach einem bestimmten Ritual vor dem Öffnen auf den Tisch zu klopfen habe. Die Fortgeschrittenen in dieser Disziplin setzten sich dazu noch während der Verköstigung, welche im Übrigen freihändig zu absolvieren sei, das Fläschchen zwischen die Zähne geklemmt, die Verschlusskappen der Fläschchen auf ihre Nasen, und so gehe das den ganzen Abend und die ganze Nacht, bis schließlich irgendein Gerlach oder Hock oder Zang von lautem Gelächter begleitet von der Bank fiele. Hinzu komme dieser fürchterliche Dialekt, der von einer solchen harschen Grobheit sei, wie man es sich kaum vorstellen kann, wenn man nicht tatsächlich dort durch die Straßen laufe und ihm von früh bis spät ausgesetzt sei, denn er setze sich zusammen aus dem Hessischen und dem Fränkischen, welche für sich genommen ja schon die fürchterlichsten Dialekte seien, die das Deutsche anzubieten habe. Wie die Aschaffenburger immerzu horsch! sagten, wenn sie jemanden zum Zuhören bewegen wollen, so Steindörfler, das sei eine einzige phonetische Grausamkeit und habe zur Folge, dass man beim Hören dieses Wortes immer zusammenzucke wie nach einem militärischen Kommando. Es sei auch völlig ausgeschlossen, sich die Wörter horsch! und bitte in ein- und demselben Satz vorzustellen. Überhaupt sei es schwer vorstellbar, wie ein Aschaffenburger das Wort bitte in den Mund nehmen könne, ohne dass es klinge, als benutze er gerade einen komplizierten lateinischen Ausdruck. Der Aschaffenburger an sich könne im Prinzip überhaupt nicht bitte sagen. Im Zusammenhang mit dem Wort horsch sei übrigens unbedingt auch noch das ähnlich klingende Wort Worscht zu erwähnen, was sowohl eine Wurst bezeichnen kann als auch Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringen und somit zwei der wichtigsten Grundlagen des Aschaffenburger Lebens in sich vereine, denn man sei tatsächlich gegenüber vielen Dingen und vor allem seinen Mitmenschen gegenüber völlig gleichgültig, und man esse in Aschaffenburg auch in der Tat laufend Wurst. Es ließe sich in diesen Wortschatz noch das Wort Dorscht einreihen, welches den gleichen Lautverschiebungsregeln folge. Man könne sich also ohne Weiteres einen Aschaffenburger vorstellen, wie er vor einem Stand auf einem dieser besagten Bierfeste stehe, die Worte horsch Worscht Dorscht äußere, und daraufhin umstandslos eine Bratwurst und einen Maßkrug mit Bier ausgehändigt bekäme. Diese Worte seien gewissermaßen die sprachliche und philosophische Grundlage des Aschaffenburgerseins.
Er, Steindörfler, sei vor einigen Jahren für einen nicht näher benannten künstlerischen Auftrag nach Aschaffenburg gekommen. Es sei ihm aber sehr schnell klar geworden, dass es unmöglich sei, diesen Auftrag auszuführen, denn die Stadt habe seinen Kunstsinn und sein Talent innerhalb kürzester Zeit verschluckt, wie eine Krankheit haben die Spaziergänge durch die Frohsinnstraße oder die Würzburger Straße nach und nach jegliche kreative Energie aus ihm gesogen, von einem Tag zum anderen habe er mehr von dem Aschaffenburgerelend in sich aufgenommen, jede im Schlappeseppel verspeiste Wurstsemmel sei ein Sargnagel für seine künstlerische Tätigkeit gewesen. Es sei aber von Vornherein ein idiotischer Plan gewesen, sich ausgerechnet in Aschaffenburg der Kunst widmen zu wollen, denn es habe hier im Prinzip seit dem sechzehnten Jahrhundert, seit der Zeit des Malers Matthias Grünewald, keinen einzigen Künstler mehr gegeben. Die ganze Stadt sei von einer allumfassenden Kunstfeindlichkeit durchsetzt. Der einzige Künstler, den es einmal nach Aschaffenburg verschlagen habe, sei der Dichter Brentano gewesen, aber der sei mehr oder weniger unmittelbar nach Ankunft in Aschaffenburg verstorben. Vermutlich sei er einfach der Aschaffenburger Kunstfeindlichkeit erlegen, vermutlich habe dieser Menschenschlag mit seinem bösen Blick und seinem poesieimmunen Dialekt den Dichter Brentano in kürzester Zeit zugrunde gerichtet. Was die Aschaffenburger im Übrigen nicht daran hindere, alle möglichen Einrichtungen nach diesem Dichter zu benennen. Man stelle sich das einmal vor, so Steindörfler, da fährt ein Dichter in diese Stadt, wird von den Einheimischen vernichtet und sogleich für alle unmöglichen Zwecke missbraucht, das sei ja quasi eine Form von Kannibalismus. Alle Brentanoorte in der Stadt seien bemerkenswerterweise unfassbar hässliche Orte. Dies gelte zum Beispiel für den Brentanoplatz, den man eigentlich nach einem pädophilen Priester oder einem christsozialen Politiker benennen müsste, und Gleiches ließe sich ebenso über die Brentanostraße sagen; auch die Brentanoschule habe einen derart üblen Ruf, dass man meinen könnte, es sei dies eine besonders hinterhältige Art der Aschaffenburger, sich an dem Dichter zu rächen, der es gewagt hatte, sich als Künstler nach Aschaffenburg zu begeben. Sowieso sei der Aschaffenburger von perfider Hinterhältigkeit, so Steindörfler. So sei es unter den Jugendlichen der Stadt neuerdings ein beliebter Sport, nächtens mit dem Auto herumzufahren, bis man auf einen alleine umherlaufenden Passanten treffe, woraufhin man gemeinsam aus dem Auto springe, den Passanten verprügele und sich anschließend wieder ins Auto setze, um daraufhin weiter durch Aschaffenburg zu fahren, beispielsweise nach Schweinheim oder nach Gailbach. Diese Hinterhältigkeit werde zu allem Überfluss auch noch gepaart mit einem grotesk übersteigerten Lokalpatriotismus. Es gebe andere deutsche Provinzstädte, so Steindörfler, wo man sich dieser Hölle, in der man sich befindet, bewusst sei, und wo folglich jeder, der bei einigermaßen klarem Verstand sei, das Ziel habe, dieser Hölle so schnell wie möglich zu entfliehen. Niemand versuche beispielsweise ernsthaft, sich die Stadt Neubrandenburg oder die Stadt Vechta schönzureden, und den Menschen dort sei ihr eigenes Gescheitertsein in jedem Moment ihrer Existenz auch voll und ganz bewusst. Der Aschaffenburger hingegen suhle sich geradezu in seinem lächerlichen Lokalstolz, halte das Schloss für das Schönste, das Bier für das Beste und sich selbst kraft seiner Aschaffenburger Herkunft für ein besonders prachtvolles Exemplar der Gattung Mensch. Diese Ansicht werde durch die lokale Propagandamaschinerie, die natürlich ebenfalls von Aschaffenburgern gesteuert werde, voll unterstützt. Dies diene einzig und allein dazu, die Aschaffenburger lebenslang in ihrem Aschaffenburgersumpf versumpfen zu lassen, so dass irgendwann die schiere Möglichkeit des Wegzugs, und sei es auch nur in die nahegelegenen, ähnlich öden Städte Würzburg oder Darmstadt, eine Unmöglichkeit darstelle. Dieser Aschaffenburgersumpf, so Steindörfler weiter, lasse einen im Übrigen nie wieder los, er begleite einen wie ein fauliges Odem, wo immer man hinkomme, denn wenn ein Aschaffenburger tatsächlich aus dem Aschaffenburgersumpf ausbrechen kann und an einem anderen Ort vielleicht sogar etwas erreicht, dann setze eine geradezu kultische Verehrung und die Rückführung aller Erfolge betreffender Person auf ihre Aschaffenburger Herkunft ein, obwohl diejenige höchstwahrscheinlich über nichts auf der Welt so froh ist wie darüber, nicht mehr in Aschaffenburg sein zu müssen. Ein Beispiel hierfür sei der Fußballtrainer Magath, an dessen Persönlichkeit man im Übrigen das Aschaffenburger Wesen recht eindrücklich abgebildet sehe, denn er gelte in der Branche als grausamer Diktator. So, schloss Steindörfler, sei es also um das Leben als Aschaffenburger bestellt.
Und du, so Petermann zu Steindörfler, was hast du jetzt für Pläne? Willst du wegziehen?
Ist mir Worscht, so Steindörfler zu Petermann, und biss ein weiteres Mal in seine Wurstsemmel.