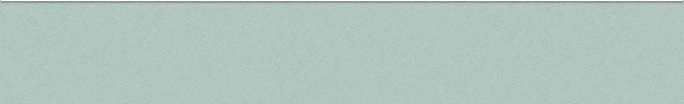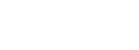Elmar Schenkel
Elmar Schenkel:
Hugo Kükelhaus und sein Träumling
Kükelhaus war auch ein großer und eigenwilliger Zeichner und Künstler. Stärker noch als in den philosophisch-ökologischen Schriften zeigt sich im Duktus seiner Tuschefeder – ebenso wie in seiner schwingungsreichen Handschrift – die Lust am Ergreifen und Begreifen der Welt. Noch immer tauchen aus dem Nachlaß Bildserien auf, etwa Illustrationen zu russischen Sprichwörtern oder Märchenbilder.
In den fünfziger und sechziger Jahren schuf Kükelhaus eine Serie von Bildgeschichten über eine kindliche Figur, eine Art alter ego, den Träumling. Nicht von ungefähr ist der Name der Figur verwandt mit dem Däumling des Märchens: klein, eulenspiegelig, weise unterläuft er alle Systeme, ob weltanschaulicher oder wirtschaftlicher Art. Ein weiterer Vetter ist der Greifling, Kükelhaus' Holzspiel- und Anfaßzeug, das er auch Allbedeut genannt hat. Woher rührt die Verwandtschaft denn? Kükelhaus setzt auf die Kraft des Kleinen, des Verborgenen und Ohnmächtigen. Wie ein alter Taoist oder Christian Morgenstern interessiert er sich nicht für die Substanzen, sondern deren Verhältnisse – die Zwischenräume und Zwischendinge: „Träumling ist ein Zwischenwesen von Mensch, Tier, Pflanze und Stern.“
Neulich wurde ein Astronom im Radio gefragt, ob er sich denn als kosmisches Wesen fühle. Er wußte es nicht, der Arme, die Frage war ihm nicht wissenschaftlich genug: da haben ihm seine ganzen langen Studien
nichts genützt. Wer sich in Kükelhaus tuschigen Wuschelkopf vertieft, wird kein Problem haben, die Frage für sich zu beantworten. Träumlings Beruf ist Staunen: ahnungslos und hellwach zugleich ist er. So entwickelt oder erzählt Hugo Kükelhaus Parabeln nach, die aus den alten Schatzhäusern Chinas und Europas stammen, aus den Märchen und Sprichwörtern oder aus der eigenen Erfahrung. Die Bilder kommen mit wenig oder gar keiner Sprache aus. Jede Geste, jede Haltung ist ein Geisteszustand, den man versteht oder der einem hilft, sich neu zu verstehen. Das kann etwa die Art sein, in der Träumling eine Wasserschale unter die Wurzeln eines Baumes hält oder einem Mistkäfer nachsinnt, der in einem Kuhfladen verschwindet. In einer weiteren Geschichte zaubert Träumling aus einem Schmutzfleck auf dem Poncho eine Schönheit hervor, indem er den Schmutzfleck einfach verdoppelt. Und lehrt uns wie nebenbei, wie wichtig Symmetrie ist für unser Wohlbefinden. Noch wichtiger jedoch ist die Faltung, das Falten des Einfältigen zu einem Vielfältigen und umgekehrt. Die Symmetrie darf nicht erstarren lassen, sondern ist immer nur Teil eines Prozesses, der kippt und wieder aufgefangen wird. Es sind diese Momente, die das Dasein ausmachen.
Wenn diese Einfalt nicht schon heilig ist, so ist sie doch verschmitzt. Der Weg zur Kultur- und Gesellschaftskritik ist damit vorgezeichnet. In einer Stadt im Reich der Frösche sind Stelzbeine Mode geworden. Damit die Kinder rechtzeitig ihre edelsteingeschmückten Stelzen tragen können, schneidet man ihnen früh die Beinchen ab. Doch da gibt es Widerstand bei den Kleinen und sie wenden sich an Träumling. Der hilft ihnen, indem
er ihnen zeigt, wo und wie sie ihr Element finden – den Teich. Froh entschwinden sie ins Wasser, während Träumling ihren glucksenden Strudeln nachsinnt.
Propagiert Kükelhaus hier und anderswo nicht schlichtweg eine Flucht aus schwierigen Verhältnissen? Er propagiert nichts, sondern erzählt eine Geschichte, aus der jeder selber klug werden darf. Der Weg zurück ins Element ist selbstverständlich eine Flucht vor der kaputten Welt der Erwachsenen – der Medien, der Prothesen und Ersatzteile. Nur ist diese Flucht eigentlich eine Flucht vor der Flucht. Denn die Welt der modischen Stelzen ist selbst eine Flucht vor dem Element, eine Negation des Wassers, das hier Leben heißt. Unsere sogenannte Realität besteht aus einem rasant anwachsenden Bereich, in dem die Flucht elektronisch aufgerüstet ist und in dem die Knöpfe und Monitore blinken wie jene Edelsteine an den Stelzbeinen der Frösche.
So mag man das gesamte Werk von Hugo Kükelhaus – das künstlerische, architektonisch gestaltende und das philosophisch-schriftstellerische – als den Versuch einer solchen Rückführung auf das Element deuten. Element ist hier nicht als Ding oder Umwelt zu verstehen, als Urschleim und Ursprung, sondern als die Frische der Wahrnehmung, als das Angerührtwerden vom Phänomen, dem Teich, in dem wir uns körperlich- geistig-seelisch wohlfühlen und entwickeln können. Doch dieser Rückweg nach vorne ist uns verbaut durch uns selbst. Träumling wie Kükelhaus beginnen daher „stets dort, wo die Rechnung aufhört und wo die Mittel erschöpft sind.“
Am besten also beim Kind. Es gibt viele Geschichten über Kükelhaus und die Kinder. In seinem letzten Vortrag, im Herbst 1984, erzählte Hugo Kükelhaus eine solche Geschichte. Er hatte einem Mädchen einen Doppelquarz geschenkt, durch den man die Regenbogenfarben sehen. Das Kind legte sich den Kristall unter das Kopfkissen. Im Alter von acht Jahren erkrankte es an Leukämie. Das Mädchen wußte, daß es sterben mußte. Wochenlang hatte es nur eine Sorge: Was soll ich dem lieben Gott mitbringen? Puppenstuben hat er genug, auch anderes. Eines nachts rief es seine Mutter: „Ich weiß, was ich dem lieben Gott mitbringe: den Stein vom Herrn Kükelhaus! Wenn er dadurch sieht, dann sieht er die wunderbare Welt, dann freut sich der liebe Gott.“ Wenige Tage nach seinem Vortrag starb Hugo Kükelhaus selbst. Man fragt sich, was er dem lieben Gott mitgebracht haben wird. Kükelhaus erzählte gerne Geschichten, in denen sich Anleitungen zum Leben verbargen. Seinen Zuhörern empfahl er damals: „Schenken Sie Kindern Kristalle!“ 16 Jahre nach seinem Tod stellen wir fest, daß wir unseren Kindern viele Kristalle geschenkt haben, aber es sind andere - solche, die sich in Computern, Gameboys und Fernsehgeräten befinden, in Geräten, die der Wirklichkeit ihre Farbe gestohlen haben und die die Kinder der Wirklichkeit beraubt haben. Schenken wir ihnen und uns also Träumlinge. Sie könnten helfen, die Kristalle wiederzufinden, die er meinte.
Dieser Beitrag erscheint im nächsten Jahr zusammen mit weiteren Beiträgen von Elmar Schenkel über Hugo Kükelhaus im Verlag der Leibniz Büchwarte